Früher waren Journalisten für mich Helden. Vor allem die, die Skandale aufdecken. Mittlerweile finde ich, dass Skandalisierungen mit Schuld daran sind, wieso Journalisten das Vertrauen flöten geht. Weil die Berichterstattung eher nach Kampagne riecht. Aber wer Medien kritisiert, muss aufpassen, man ist ja gleich ein kleiner Trump.
Wie ich herausgefunden habe, leide ich an Medienskepsis. Ich bin also Medien gegenüber misstrauisch. Und das auch noch als Journalistin. Es ist längst nicht so schlimm um mich bestellt wie um andere Leute, die gleich die wahnwitzigsten Dinge herbeifantasieren.
Die davon überzeugt sind, dass die etablierten Medien und die Politik zusammenarbeiten, um die Meinung der Bevölkerung zu manipulieren zum Beispiel. Oder noch krasser, glauben, dass die Menschen von den Medien systematisch belogen werden. Dass das so nicht stimmen kann, weiß ich schließlich aus meinem Journalisten-Alltag.
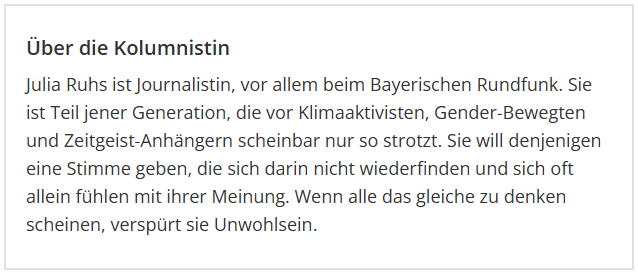
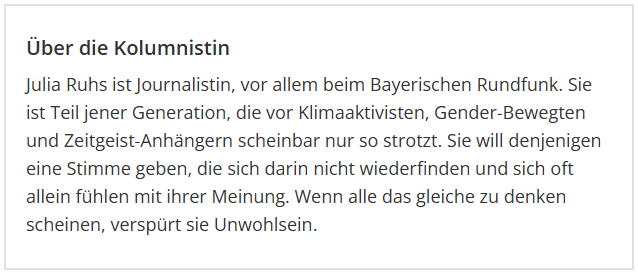
Aber ich gebe zu, ich habe einen kritischen Blick auf die Medien entwickelt. Gerade in den letzten Jahren. Früher war eigentlich noch alles in Ordnung mit meinem Medienbild und mir.
Früher Helden, heute für mich eher Teil des Problems
Damals wollte ich nämlich Investigativ-Reporterin werden. Also eine von denen, die Skandale aufdeckt. Als ich mich vor einigen Jahren um ein Journalismus-Stipendium bewarb, schrieb ich diesen Berufswunsch in meine Bewerbung. Für mich waren Investigativ-Journalisten Helden. Menschen, die gegen einen schier übermächtigen Staat die Wahrheit ans Licht bringen – toll. Es klang nach einem Job, in dem man mit journalistischer Gewieftheit Kriminalfälle löst und sowieso viel schlauer ist als die Polizei.
Heute ist der Investigativjournalismus für mich eher eine Problemdisziplin. Mit Schuld daran, der Journalistenzunft das verbliebene Vertrauen zu rauben. Mit zugegeben angefressener Miene habe ich gelesen, dass ausgerechnet zwei Recherchen jetzt auch noch Journalistenpreise verliehen bekommen: die „Correctiv“- und die Aiwanger-Flugblatt-Recherche. Für mich sind das beides Beispiele, wie man es lieber nicht machen sollte. Weil es statt Investigation eher nach minutiös geplanter Kampagne riecht. Nach Agenda-Journalismus, mit dem Ziel, eine bestimmte politische Richtung zu pushen.
„Correctiv“ – das war das Recherchezentrum, welches das „Remigrationstreffen“ oder auch genannt „Geheimtreffen“ von Politikern und Rechtsextremen in einem Potsdamer Hotel aufdeckte. Das so geheim eigentlich gar nicht war. Und Hubert Aiwanger, das war (und ist) der nicht gerade auf den Mund gefallene, stellvertretende Ministerpräsident in Bayern, der vor über 35 Jahren in seinem Schulranzen ein antisemitisches Flugblatt verstaut hatte. Dem die „Süddeutsche Zeitung“ unterstellte, dass er es bestimmt auch geschrieben haben dürfte. Beide Fälle schaukelten sich hoch zum Rechtsextremismus-Skandal. Zumindest taten plötzlich viele so, als ob Aiwanger ein ganz schlimmer Antisemit mit zu viel Hitlerliebe sei und die Potsdamer Hotelgäste Massendeportationen von Millionen von Ausländern planten. In meinen Augen war alles deutlich harmloser.
Es ist ein schmaler Grat zwischen Journalismus und Aktivismus
Ich erkläre gern einmal warum. „Correctiv“ und ich haben nämlich eine Vorgeschichte. Da ich vor einigen Jahren unbedingt Fuß in der Investigativ-Welt fassen wollte, machte ich ein Praktikum. Sieben Wochen verbrachte ich bei Correctiv in Berlin. Ich recherchierte in Sachen AfD (logisch) und über illegale Müllentsorgung innerhalb der EU. Es war keine schlechte Zeit dort. Ich bewunderte das Sitzfleisch, das die Redakteure dort hatten, den Eifer. Der mir bei dieser Sache fehlte, wie ich feststellte. Es war nicht ganz meine Welt.
„Linksgrün versifft und stolz drauf“
Als ich einen Zettel an einer Pinnwand mit der Aufschrift „linksgrün versifft und stolz drauf“ entdeckte, dämmerte mir ein Teil meines persönlichen Problems. Und als ich den unangenehmen Fehler beging, einmal anzumerken, dass ich es gar nicht schlimm fände, wenn es auch künftig eine absolute Mehrheit der CSU in Bayern gäbe – die war damals im Begriff dahinzuscheiden (es war 2017) – erinnere ich mich noch gut an den entsetzten Blick einer Kollegin.
Seitdem glaube ich, investigativer Journalismus lebt häufig vom inneren politischen Antrieb. Vom fließenden Übergang zwischen Journalismus und Aktivismus. Davon, die Gesellschaft verändern oder sie – wie beim Thema Rechtsextremismus – wachrütteln zu wollen. Irgendwoher muss ja der Biss kommen. Das Durchhaltevermögen.
Hubert Aiwanger droht in Bayern erneut mitzuregieren? Die AfD und Rechtsextreme sind im Aufwind? Da fangen manche Journalisten eben etwas engagierter an zu wühlen, dort, wo es ihnen politisch gut in den Kram passt. Um diejenigen mit publizistischen Mitteln kleinzukriegen, die sie nicht mögen. Zumindest ist das mittlerweile mein Eindruck. Dass das alles eine Art Trick ist. Ich sagte ja, ich bin mittlerweile ein wenig misstrauisch, was Medien betrifft.
Wenigstens schaue ich nicht doof aus der Wäsche
Aber wenigstens schaue ich nicht doof aus der Wäsche, wenn es doch anders kommt, als es sich die journalistischen Beobachter ausmalen. Ich verspüre noch immer große Schadenfreude, wenn ich an die bayerischen Landtagswahlen 2023 zurückdenke und an das bombastische Ergebnis der Aiwanger-Partei. Das nur zustande kam, weil die „Süddeutsche Zeitung“ eigentlich das Gegenteil bezweckte und die Freien Wähler mithilfe der Flugblatt-Affäre klein schreiben wollte. Das sprang einem aus den Artikeln und der Veröffentlichungsstrategie ja förmlich entgegen, ich habe die Causa penibel genau mitverfolgt.
Ähnlich ulkig: Katharina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin, die sich nach der Europawahl über das gute Ergebnis der AfD wunderte. Darüber, warum die „Demokratiebewegung“ von Anfang des Jahres nicht stärker gefruchtet hat. Sie meinte die Demos gegen „rechts“, bei denen tausende Menschen ausgelöst durch die „Correctiv“-Recherche auf die Straße gingen. Sie war sicherlich nicht die einzige, auch ein paar Redakteure dürften geschnauft haben, als die Demos sich nicht im Wahlergebnis wiederfanden. Dabei hat man doch so sehr getrommelt.
Man ist erst verloren, wenn die Bevölkerung an den Skandal glaubt
Der Kommunikationswissenschaftler Hans Mathias Kepplinger hat mal gesagt: Man ist erst dann verloren, wenn die Öffentlichkeit an den Skandal glaubt. Offenbar hat längst nicht die ganze Öffentlichkeit an die zwei Skandale geglaubt. Vor allem nicht diejenigen, die man mit der überzogenen Skandalisierung bekehren wollte. Dumm, dass man genau für die das Gespür verloren hat.
Aber mit Kritik an Journalisten muss man ja ein wenig vorsichtig sein. Zu schnell wird einem ein rechtspopulistisches Weltbild unterstellt. Dass man genauso sei wie Donald Trump, der beschimpfe schließlich auch ständig die Medien. Pauschale Medienkritik verfange besonders bei einem „bestimmten Teil der Bevölkerung“ lese ich öfter. Wo ich mich immer frage, was das für ein „bestimmter Teil der Bevölkerung“ sein soll – die Zurückgebliebenen, die geistig Verwirrten, Dunkeldeutschland? Und bin ich da jetzt schon mitgemeint?
Mein Problem mit einigen Journalisten ist: Sie sehen sich selbst als Aufklärer, die über dem Rest der Gesellschaft stehen. Deshalb versuchen sie auch so gern, das Denken der Menschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber sie überschätzen sich und ihre Macht. Und unterschätzen den Groll, den ihre Überheblichkeit bei vielen auslöst. Der davon genährt wird, dass Realitätsdarstellung in den Medien und Realitätswahrnehmung vieler Menschen inzwischen auseinanderklafft.
Statt Investigativjournalismus lieber „Fast Food“
Weil ich dem Investigativjournalismus also nicht mehr so wohlgesonnen gegenüberstehe, mache ich, seit ich beim „Bayerischen Rundfunk“ angefangen habe, hauptsächlich das Gegenteil. Ich nenne es „Fast-Food-Journalismus“. Was heißt: vor allem tagesaktuelle Berichterstattung. An einem Tag das eine, am nächsten gleich ein neues Thema, nichts Investigatives, kein Wühlen. Damit gewinnt man schwerlich irgendwelche Journalistenpreise, aber was soll’s. Fast Food mag ich eigentlich eh ganz gern.



